Bildung und Forschung, Wissenschaft und Innovation: Was sind die Themen, die das Jahr 2020 bestimmen werden? Ein subjektiver Jahresausblick in fünf Teilen – an jedem Tag in dieser Woche.
Foto: Gerd Altmann / pixabay - cco.
Muss Deutschland (sich) neu erfinden?

Die Schlagzeilen um den Jahreswechsel herum lasen sich nicht gut. "2020" könnte zum Desaster werden", titelte Spiegel Online. Gemeint war der Automarkt in Deutschland. Und: "Aus purer Angst verpasst Deutschland enorme Chancen". Dieses Zeugnis stellte Christian Klein, Co-Chef des Softwarekonzerns SAP der Bundesrepublik im Spiegel aus. Die Stuttgarter Zeitung fragte: "Wird Künstliche Intelligenz vernachlässigt? ... Gerät die Wettbewerbsfähigkeit des Landes in Gefahr?" Die taz wiederum zitierte, irgendwie passend, einen Migrationsexperten und seine Wertung des neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetzes: "Am Ende werden nur wenige herkommen."
Waren die Deutschen nicht immer so stolz auf ihre Innovationskraft? An der Schwelle zum neuen Jahrzehnt scheint von diesem Selbstbewusstsein nicht mehr viel übrig zu sein. Die Autoindustrie rutscht in einen Existenzkampf, ihre Chefetagen haben zu spät den tiefgreifenden Wandel erkannt, den Klimakrise, Elektromobilität und KI bedeuten. Sie haben zu lange geglaubt, auch dieses Mal würde die bewährte deutsche Strategie – schrittweise Innovationen bei gleichbleibend hohem Qualitätsanspruch – reichen. Damit wird die Automobilsparte, seit Jahrzehnten die deutsche Schlüsselindustrie, zum Symbol für die Grenzen des deutschen Modells insgesamt. Wo ist die Begeisterung hin, die Faszination über die Möglichkeit des Neuen, der Glaube an gerade erst entstehende Technologien und an ihr Potenzial, dringend benötigte Lösungen für große gesellschaftliche Fragen zu bieten?
Nein, es stimmt nicht, dass die Deutschen nur noch Skepsis können, nur noch Schadenbegrenzung und ängstliches Hinterfragen. Bewiesen hat das ausgerechnet die Entscheidung desjenigen amerikanischen Autobauers, der mit seinem Aufstieg die Zukunftsschwäche der deutschen Konkurrenz so überdeutlich macht: Tesla will eine seiner sogenannten Gigafactories in Brandenburg errichten – und löste schon mit der Ankündigung im November hierzulande einen Gefühlssturm aus, wie ihn lange kein deutsches Unternehmen mehr hat erzeugen können. Lobeshymnen, Proteste, Neugier, Kopfschütteln, alles dabei und alles echte Gefühle. Und mittendrin Wirtschaftspolitiker aus Land und Bund, die sich ein wenig zu sonnen versuchen in dem Glanz des Silicon Valleys.
Innovative Unternehmen und Produkte müssen die Fantasie anregen, um sich entfalten zu können. Wie lange wird es dauern, bis Volkswagen, Porsche oder gar Miele das wieder schaffen? Klar ist: Sie müssen es. Sonst werden sich die Leute in Deutschland und Europa diese Gefühle weiter bei Google, Apple, Netflix oder Tesla suchen. Sonst wird die Diagnose von SAP-Mann Klein die deutschen 20er Jahre prägen.
Die Chancen, dass der Aufbruch gelingen wird, stehen zum Glück nicht so schlecht, wie es auf den ersten Blick aussieht zurzeit. Stichwort KI: Deutschlands Entwickler sind zwar in einigen anwendernahen Bereichen komplett abgehängt, in der Grundlagenforschung, etwa zur vermeintlichen Tesla-Domäne autonomes Fahren, sind sie aber vorn mit dabei. Und ja, es fehlt an Risikokapitalgebern, doch zugleich investiert kaum ein anderes großes Industrieland so viel in Forschung und Entwicklung: Die 3-Prozent-Hürde (Anteil an der Wirtschaftsleistung) wurde 2018 übersprungen, auch dank massiver staatlicher Investitionen.
Der Weg von einer grundlegenden Erkenntnis, einer guten Idee bis hin zu einem funktionierenden Produkt war in der Vergangenheit zu weit, oft gar unpassierbar. Dass Deutschland sein Innovationsmodell, das langsame, vorsichtige Vorantüfteln, wenn schon nicht grundlegend neu erfinden, so doch beherzt ergänzen muss, ist inzwischen Konsens auf politischer Ebene – und hat unter anderem zur Gründung der sogenannten Agentur für Sprunginnovationen geführt, die in diesem Jahr so richtig loslegen soll.
Innovation in Form großer Sprünge und, wo nötig, auch mal schmerzhafter Disruptionen: Agenturchef Rafael Laguna de la Vera soll den deutschen Entwicklern den Mut zum Risiko beibringen – und ihn belohnen. Natürlich kann eine Agentur mit 100 Millionen Euro Jahresbudget (im Ausbauzustand) keinen großen Hebel ansetzen, aber sie kann die Stimmung ein Stückweit prägen, die Fantasie anregen, neue Lust auf Fortschritt machen. Klar ist, dass dieser Fortschritt nicht auf Kosten von Umwelt und Klima und gegen den sozialen Zusammenhalt gelingen kann, sondern nur in Einklang mit ihnen. (06.01.20)
Hat die Kultusministerkonferenz eine Zukunft?

DER ANTEIL DER Risikoschüler steigt, ein Fünftel der Neuntklässler kann nicht richtig lesen, und diejenigen, es können, haben zu einem großen Teil keinen Spaß daran: Die Ergebnisse der jüngsten PISA-Runde boten schon für sich allein genommen genug Stoff für die großen bildungspolitischen Debatten. Nimmt man die Digitalstudie ICILS hinzu (ein Drittel der deutschen Schüler hat IT-Kompetenzen nahe null), den massiven Lehrermangel (Lehrerverbands-Präsident Meidinger sprach zuletzt angesichts der vielerorts mangelhaften Quereinsteiger-Qualifizierung von einem "Verbrechen an den Kindern") oder auch den innerdeutschen IQB-Bildungstrend (dass die Matheleistungen stagnieren, ist schon ein Erfolg), müsste sich die Bildungspolitik zu Jahresanfang 2020 eigentlich auf den Titelseiten der Tageszeitungen wiederfinden. Tut sie auch. Allerdings aus anderen Gründen. Gerade erst haben die Ministerpräsidenten (ganz vorn der Bayer Markus Söder) den Nationalen Bildungsrat abgeschossen, jetzt streiten sie über die künftige Verteilung der Ferienzeiten. Mit Leidenschaft. Mit Ausdauer. Und in einer vorausschauenden Pünktlichkeit noch dazu: Die aktuelle Regelung läuft Ende 2024 aus.
Im Ernst: Es ist ein Trauerspiel, das da gerade aufgeführt wird. Und die Kultusminister machen in der zweiten Reihe fleißig mit. Wahrscheinlich sind sie froh, dass es überhaupt mal um ihre Themen geht.
Zu ihrer Ehrenrettung ist zu sagen: Es gibt unter ihnen eine ganze Menge, die es sich anders wünschen würden. Die sich sogar mit dem ungeliebten Bildungsrat angefreundet hatten, der dem Bund eine lange nicht mehr gesehene Rolle in der Bildungspolitik zugestanden hätte. Der aber eben nach Meinung vieler Experten auch Rückenwind bedeutet hätte für den bildungspolitischen Aufbruch, den alle fordern, für eine nationale Kraftanstrengung hin zu mehr Vergleichbarkeit zwischen den Bundesländern und Schulabschlüssen, zur konsequenten Weiterentwicklung nationaler Bildungsstandards, deren Logik ja längst angelegt ist. Doch Söder und seine Mitstreiter haben nicht nur den Bildungsrat beerdigt, sondern die Debatte gleich dazu, indem sie die dankbaren Medien virtuos auf den Ferienstreit-Holzweg führten.
Die Kultusminister haben ihrerseits auf den Abschied von dem ungeliebten neuen Gremium mit einem doppelten Versprechen reagiert. Nummer eins: Die Vorteile, die der Bildungsrat gebracht hätte, retten wir, indem wir einen neuen wissenschaftlichen Beirat gründen, allerdings nach unserer eigenen Vorstellung und ohne den Bund mitreden zu lassen. Nummer zwei: Wir schaffen den bildungspolitischen Aufbruch, indem wir Länder einen neuen grundlegenden Bildungsvertrag schließen, in dem wir alle wichtigen Zukunftsfragen einvernehmlich regeln, vom Abitur bis hin zur Lehrerbildung, plus der notwendigen Konkretisierungen der großen Linien in einer Reihe begleitender Absichtserklärungen.
In Wahrheit haben viele Minister nie
an einen Staatsvertrag geglaubt
Beide Versprechen sind hoch gepokert. Die Vorstellung, die die Kultusminister von ihrem neuen Beirat haben, kann man getrost rudimentär nennen. Oder auch konstatieren: Außer dem Schlagwort und einer nicht abgestimmten Stoffsammlung auf Seiten der Unionsminister hatten sie vor Weihnachten noch gar nichts. Und was den "Bildungsvertrag" angeht, so ist schon das neuerdings verwendete Wording verräterisch. Denn ein Staatsvertrag wird es aller Voraussicht nach nicht werden, auch wenn gerade CDU-Kultusminister lange so getan hatten, als sei die Textform Staatsvertrag quasi schon gedeichselt. Als Grund wird jetzt gern genannt, dass Thüringens nächste Landesregierung voraussichtlich keine stabile Parlamentsmehrheit haben wird.
In Wahrheit haben viele Kultusminister jedoch nie an den Staatsvertrag geglaubt, weil der entweder an den 16 Regierungschefs oder Parlamenten gescheitert wäre oder, um dies zu verhindern, so viele Allgemeinplätze enthalten hätte, dass es peinlich geworden wäre. Selbst das legendäre Hamburger Abkommen von 1964, das letzte seiner Art, um das deutsche Schulwesen zu vereinheitlichen, hatten nur die Ministerpräsidenten geschlossen.
Doch auch diese, vor allem auf SPD-Seite favorisierte Alternative (also ohne Parlaments-Zustimmung, aber mit Unterschrift der Ministerpräsidenten) scheint fraglich geworden zu sein, denn auch dazu müssten sich die Kultusminister ihren bildungspolitisch zwischen Desinteresse und, siehe oben, Aktionismus schwankenden Regierungschefs ausliefern.
Was aber bringt das schönste und ambitionierteste Papier (und es ist durchaus schön, das da gerade entsteht), wenn die Kultusminister allein es beschließen? Es ist ja dies gerade die Eigenheit der Kultusministerkonferenz (und ihre größte Schwäche?), dass ihre Beschlüsse keinerlei rechtliche Verpflichtung bedeuten.
So sind die Aussichten nicht gering, dass die KMK am Ende des Jahres 2020 dasteht ohne Staatsvertrag, ohne Abkommen, dafür aber mit den üblichen Absichtserklärungen der Kultusminister, an die man sich halten kann oder auch nicht.
Ob dies reichen wird, um den von der Mehrheit der Deutschen abgelehnten Bildungsföderalismus wieder populärer zu machen? Ob dadurch die Kultusministerkonferenz, die ihn verkörpert, neue Vitalität und Orientierung gewinnt? Zu wünschen wäre es ihr, denn die Schwäche der KMK mag für vieles als Beleg dienen, sicher aber nicht dafür, dass die Alternative bildungspolitischer Zentralismus irgendetwas besser machen würde.
Vielleicht aber tut sich ja tatsächlich etwas. Die neue KMK-Präsidentin Stefanie Hubig (SPD), im Hauptberuf Bildungsministerin von Rheinland-Pfalz, hat Anfang Januar von ihrem hessischen Kollegen übernommen. Sie gilt als durchsetzungsstark und schwört die Minister in ihrer ersten KMK-Pressemitteilung auf eine gemeinsame Kraftanstrengung ein. "Bei aller Wahrung der Bildungshoheit der Länder müssen wir gemeinsam daran arbeiten, die Aufgaben, die sich der Bildungspolitik in ganz Deutschland stellen, zu lösen", sagt sie. "Das sind wir unseren Schülerinnen und Schülern schuldig." Mehr Transparenz, mehr Vergleichbarkeit also, mehr Bildungsgerechtigkeit.
Allerdings haben ihre Vorgänger bei ihrem Antritt als KMK-Präsidenten auch alle schon so ähnlich gesagt. Im März treffen sich die Kultusminister zum ersten Mal in diesem Jahr. (07.01.20)
Geht es in der Wissenschaftspolitik auch mal
wieder nicht nur ums Geld?
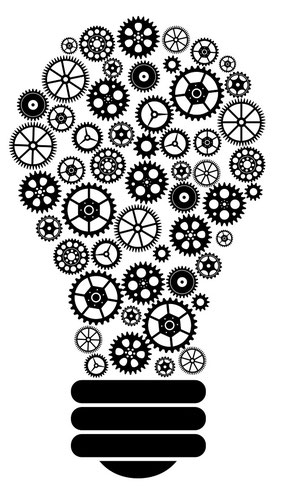
VON ANFANG AN den richtigen Ton treffen, das ist die Herausforderung. Der Toepfer-Stiftung, die im Dezember und für viele überraschend zum Träger der künftigen Organisation für "Innovationen in der Hochschullehre" auserkoren wurde, scheint sie zu gelingen. "Die Expertise für Lehrentwicklung liegt in den Hochschulen", steht auf der provisorischen Website, die die Toepfer-Leute noch am Tag der Auswahlentscheidung online gestellt haben. "Wir hören erst einmal zu, was uns erfahrene Lehrgestalterinnen und -gestalter zu sagen haben, um der neuen Organisationseinheit Anregungen für die inhaltliche Ausgestaltung der Lehrförderverfahren mit auf den Weg zu geben." Die Botschaft: Keine Sorge, liebe Hochschulen, wir werden euch nichts überstülpen, was ihr nicht wollt.
Eine wichtige Botschaft, denn die vom Bund gepushte Idee einer eigenständigen Förderorganisation für die Lehre wurde seit ihrem Aufkommen von viel Skepsis in den Hochschulleitungen begegnet; auch die Landeswissenschaftsminister traten auf die Bremse: Die Vorstellung eines neuen Akteurs, der allzu selbstbewusst die Gleichbehandlung der Lehre im Vergleich zur Forschung einfordert, behagte weder den einen noch den anderen. Mit dem Ergebnis, dass der neue Akteur nun eben nicht eigenständig sein und nur "Organisationseinheit" genannt werden darf, abhängig von einem Träger – was auch immer das praktisch bedeuten mag.
Wahrscheinlich, dass das sogenannte Bund-Länder-Gremium, das die Aufsicht über die Neugründung übernehmen soll, versuchen wird, eine möglichst enge Leine zu führen. Der Toepfer-Stiftung wiederum wird es obliegen, die Interessen behutsam auszutarieren zwischen Bund, Ländern und Hochschulen – zugunsten von denen, die tatsächlich etwas bewegen wollen in der Lehre.
Gelingt das Vorhaben, wäre es ein
wichtiges Signal für die Wissenschaft insgesamt
So diffizil sie unter diesen Bedingungen werden dürfte, die Etablierung der "unabhängigen Stimme", die der Wissenschaftsrat für die Lehre gefordert hat, klappt sie, wäre das ein wichtiges Signal für die Wissenschaftslandschaft insgesamt. Wir reden wieder ergebnisorientiert über Inhalte, über Konzepte, über Strategien – und nicht nur über Geld und dessen Verteilung.
Zwar wurde es mit Recht als großer Erfolg für die Wissenschaftspolitik gefeiert, das 160-Milliarden-Paket, das Bund und Länder vergangenen Mai in der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz ausgehandelt haben: Planungssicherheit für Hochschulen und Forschungsorganisationen bis 2030. Doch die Riesensumme konnte nicht über die Schieflage zuungunsten der Hochschulen und wiederum besonders zuungunsten der Lehre hinwegtäuschen. Am geringsten wiegt da noch die Tatsache, dass die 200 Millionen Euro pro Jahr im bisherigen Qualitätspakt Lehre es nur teilweise in die Finanzierung der neuen Organisationseinheit geschafft haben. Zum Vergleich: Dessen vorgesehenes Jahresbudget von 150 Millionen ist weniger als die Summe, um die der Haushalt des Forschungsförderers DFG innerhalb der nächsten zwei Jahre wachsen wird.
Viel Besorgnis erregender war und ist aber etwas Anderes: Das jahrelange Bund-Länder-Geschacher um die Zukunft der Hochschulfinanzierung und, parallel, das schier endlose Schaulaufen in der Exzellenzstrategie haben zu einer Inhaltslosigkeit in der Hochschul- und Wissenschaftspolitik geführt, die gefährliche Ausmaße erreicht hat. Immerzu geht es darum, wie die Länder dem Bund noch etwas mehr Geld aus den Rippen leiern können; die Wissenschaftsorganisationen messen ihren Erfolg ebenfalls in der Prozentzahl ihrer Budgetzuwächse. Die Hochschulrektoren und Institutschefs stecken ihre Claims über die Höhe der eingeworbenen Forschungs-Drittmittel ab, es geht um Macht und Einfluss und deren Verteilung. In der Bildungspolitik läuft es übrigens kaum anders: Es geht immer zu um die nötigen Milliarden für den Digitalpakt, für die Ganztagsschulen oder Kitas. Aber was damit passiert, um den Sinn und Zweck und die richtigen Konzepte geht es viel zu selten.
Damit kein Missverständnis aufkommt: Über Geld zu reden ist wichtig, vor allem in der Bildung, zumal Deutschland davon weniger lockermacht als viele andere wohlhabende Staaten. Die wahrscheinlich bis zum Sommer dauernde Hängepartie um den Zukunftsvertrag wird nicht nur für die betroffenen Hochschulmitarbeiter eine Prüfung; auch die drohenden Schönrechnereien einiger Bundesländer bei ihrer Kofinanzierung der Bundesmilliarden, von denen ich im Dezember schrieb und vor denen heute der Deutsche Hochschulverband warnte, müssen immer wieder zum Thema gemacht werden.
Gefährlich aber wird es, wenn die Debatten um Geld zum Ersatz werden für die nicht mehr stattfindenden Debatten um die drängendsten Ziele und wie diese zu erreichen wären. Vielleicht ja, weil der Streit ums Geld leichter zu ertragen und in jedem Fall intellektuell weniger beanspruchend ist als das gemeinsame Ringen um die nötigen bildungs- und forschungspolitischen Weichenstellungen.
Wo sind die Wissenschaftspolitiker und Hochschulchefs, die endlich eine Reform der Bologna-Studienreform in Angriff nehmen – sie nicht nur halbherzig anmahnen, sondern sie selbst treiben und gestalten? Die konstant hohen Abbrecherquoten fordern sie ebenso wie die seltsame deutsche Fixierung auf konsekutive Bachelor- und Masterprogramme, die die Gestaltung individueller Hochschulkarrieren, das Kombinieren unterschiedlicher Disziplinen und Studienstandorte unnötig schwermachen. Auch der Wandel der Hochschulen zu Orten der Weiterbildung und des lebenslangen Lernens wird so, wie Studieren zurzeit verstanden wird, nicht gelingen.
Wo sind die Kultusminister, die endlich die Mahnungen aus der Schulpraxis erhören und das Lehramtsstudium grundlegend neu gestalten? Vieles ließe sich diskutieren und, wenn nötig, wieder verwerfen: die Einrichtung von Lehrerbildungsakademien, eine Neuordnung oder Verschmelzung von Ausbildungsphasen, der Abschied vom Mehrfachstudium. Hauptsache, die Debatte nimmt Fahrt auf, damit die Lehrerbildung am Ende besser wird, flexibler und unabhängiger von Schweinezyklen – und damit mehr Studienanfänger auch in den Schulen ankommen. Der Bildungsforscher und frühere Vorsitzende des Wissenschaftsrates, Manfred Prenzel, hat schon 2017 einen Masterplan fürs Lehramtsstudium gefordert. Wie kann es sein, dass auch drei Jahre später Kultusminister immer noch der Auffassung sind, angesichts von Lehrermangel und Quereinsteigern sei jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für eine Reform der Lehrerbildung? Wann denn dann?
Weitere Themen, über die 2020 nicht mehr nur fleißig geklagt, sondern bei denen gehandelt werden sollte: die Drittmittelflut und der daraus resultierende Begutachtungswahnsinn; die kaum noch von jemandem bestrittenen Tatsache, dass die Tonnenlogik des wissenschaftlichen Publizierens junge Wissenschaftlerkarrieren schädigt und die Bedeutung der Lehre schmälert. Die mangelnde Diversität der deutschen Wissenschaftsszene – von den Studienanfängern bis hin zu den Postdocs und Professoren.
Diese Aufzählung ist keinesfalls vollständig. Und bei den letzten beiden Themen sind wir wieder beim Ausgangspunkt angelangt: der neuen Organisationseinheit für "Innovationen in der Hochschullehre". Wenn sich das Engagement für die Lehre als karriereförderlich erweist, wenn es sichtbar gemacht wird und wenn neue Lehrideen strahlen können, dann steigt nicht nur die Bedeutung der Lehre insgesamt. Dann nimmt auch die Vielfalt der Ideen zu, dann wird auch die Gruppe derjenigen vielfältiger, die etwas zu sagen haben im Wissenschaftssystem. Dann endlich gibt es auch eine Alternative zum Publish or Perish. Nicht all das wird eine kleine neue Förder- und Vernetzungsorganisation leisten können; aber sie kann einen Anstoß dazu liefern. Gemeinsam mit den großen Wissenschaftsorganisationen, mit den Hochschulrektoren und einer DFG, die mit Katja Becker seit Anfang 2020 erstmals eine Präsidentin an der Spitze hat.
Das große Geld in der Wissenschaft ist verteilt bis 2030. Gut so. Jetzt müssen die Ideen fliegen lernen. (08.01.20)
Wie kommt die Universitätsmedizin aus der Krise?

DAS UNIVERSITÄTSKLINIKUM HEIDELBERG hat eine neue Führungsspitze. Ingo Autenrieth, bislang Dekan der Tübinger Universitätsmedizin, und Katrin Erk, erst seit Mitte 2019 kaufmännische Direktorin des Dresdner Uniklinikums, sollen den Wiederaufstieg nach dem Skandal schaffen. Bald ist es ein Jahr her, dass die unselige Geschichte um einen angeblich revolutionären Krebstest mit Pressekonferenz und BILD-Exklusivstory ihren Anfang nahm. Ihren vermeintlichen Anfang, denn wie die Aufklärungsarbeit der eigens eingesetzten Kommission gezeigt hat, reicht die Kette zweifelhafter Vorgänge und Entscheidungen jahrelang zurück.
Der erhoffte Wiederaufstieg würde freilich voraussetzen, dass der größte Skandal, den die deutsche Universitätsmedizin seit Jahren erlebt hat, wirklich verarbeitet wäre. Doch soweit ist es noch lange nicht, viele Fragen sind nach wie vor ungeklärt: Wozu haben die Verantwortlichen überhaupt dieses große PR-Rad gedreht? Welche internationalen Dimensionen hat die Geschichte – mit dem chinesischen Pharmaunternehmen Boai NKY Pharmaceuticals, dessen Aktienkurs seit Anfang Februar 2019, besonders aber nach dem 21. Februar, dem Tag der Pressekonferenz, einen steilen Anstieg verzeichnete?
Welche Konsequenzen hat das gegen den geschäftsführenden Ärztlichen Direktor der Universitätsfrauenklinik, Christof Sohn, laufende Disziplinarverfahren? Wie endet der Rechtsstreit mit dem freigestellten und später fristlos gekündigten Klinikjustiziar Markus Jones, dessen Anwalt von einer umfassenden Entlastung durch die vorliegenden Kommissionsberichte spricht? Überhaupt: Wann kann er denn nun veröffentlicht werden, der Bericht der externen Expertenkommission, nachdem Sohn die Publikation im Oktober gerichtlich hatte untersagen lassen? Die Revision vor dem Verwaltungsgerichtshof Mannheim steht aus, die RNZ schreibt: "Siegt der Chef der Unifrauenklinik auch in dieser Instanz, kann er wohl disziplinarisch überhaupt nicht bestraft werden."
Sind die neue kaufmännische Direktorin Erk, die bis 2019 in Mannheim gearbeitet hat, und der neue Vorstandsvorsitzende und Ärztliche Direktor Autenrieth überhaupt extern genug für den Job, oder ist gerade die baden-württembergische Halbdistanz, aus der sie nach Heidelberg kommen, eine große Chance für den Neustart?
Die wichtigsten Fragen reichen
weit über Heidelberg hinaus
Und schließlich: Wie steht es um die Finanzen des hoch verschuldeten Universitätsklinikums, das 2019 mit einem 12-Millionen-Defizit abgeschlossen hat? Drohen zusätzlich millionenschwere Schadenersatzansprüche, weil das Klinikum den Bluttest-Investoren (vor allem dem Unternehmer Jürgen Harder) per Vertrag eine, wie die RNZ schreibt, "(allerdings interpretierbare) 100-Prozent-Garantie bezüglich der Zuverlässigkeit des Tests" zugestand?
Noch schwerer wiegen freilich die Fragen an das System Universitätsmedizin an sich. Es sind diese Fragen, die weit über Heidelberg hinausreichen und die unabhängig gelten davon, ob, und wenn ja, welche individuelle Schuld einzelne Akteure am Universitätsklinikum Heidelberg auf sich geladen haben.
In einem Artikel für Spektrum.de habe ich die Besonderheiten der Universitätsmedizin ausführlich beschrieben. Die einzigartige Verbindung von Wissenschaft und einem wirtschaftlichen Betrieb, den ein Universitätsklinikum bedeutet. Der Kostendruck, der dadurch entsteht, die unglaublich hohen Summen, die in der Hochschulmedizin bewegt werden. Der hohe Männeranteil in den Führungspositionen, die finanziellen Versuchungen. Die Überhöhung des Ärzteberufs, die immer noch ins Mystische reicht. Die zerstörerische Konkurrenz zwischen Professoren, Fachrichtungen und Standorten. Die außerordentlich strengen Hierarchien, die Abhängigkeiten ganzer Scharen von Privatdozenten und "außerplanmäßigen Professoren", von Doktoranden, Habilitanden, Postdocs und Assistenzärzten von einer einzigen Person: dem Lehrstuhlinhaber und Klinikdirektor. Kurzum: Medizinprofessoren, Klinikdirektoren und medizinischen Forschern fehlt in einem extrem kompetitiven Umfeld oftmals das Korrektiv, weil sie kein Gegenüber haben, das ihnen beizeiten sagt: So geht das nicht. Das System Medizin hält es für sie nicht bereit. Und das ist das eigentliche Problem der Medizin.
Vorschläge für strukturelle Reformen gibt es viele, doch sie sind meist halbherzig, weil sie aus dem System stammen, und noch seltener werden sie auch umgesetzt. Das demonstrative Hoffen auf das große Bundesgeld, um den enormen Kostendruck auf die Uniklinika zu lindern und ihnen gleichzeitig Anreize für echte Neuerungen zu geben, wird ebenfalls vergeblich sein. Dass in der Hauptstadt das bundesfinanzierte Berliner Institut für Gesundheitsforschung (BIG) Teil der landeseigenen Charité Universitätsmedizin geworden ist, ist ein grandioser, pro Jahr 75 Millionen Euro schwerer Verhandlungserfolg für den Berliner Regierenden Wissenschaftssenator und seinen Staatssekretär, genauso übrigens wie die 100 Bundesmillionen für ein Herzzentrum, mehr aber auch nicht. Und ganz bestimmt dienen diese Einzelfälle nicht als Blaupause für anderswo – eher als Anlässe für die Nachfrage, ob Berlin irgendwann mal genug bekommen hat.
Nein, mehr Geld allein wird den Weg aus der Misere nicht weisen. Das könnte nur die mutige Abkehr von den überkommenen Führungsstrukturen, für die es aber der Universitätsmedizin wahrscheinlich dann doch noch nicht schlecht genug geht. In Heidelberg dagegen möglicherweise schon – und genau dadurch ergibt sich jetzt die einmalige Chance zu einem grundsätzlichen Hinterfragen. Wahrscheinlich wird aber auch sie nicht genutzt. Oder vielleicht doch? (09.01.20)
Was sonst noch alles wichtig wird – und warum dieser Ausblick mehr als fünf Teile gebraucht hätte

AM ENDE DER WOCHE merke ich, dass die Idee mit dem Jahresausblick in fünf Teilen einen Haken hat. Irgendwann kommt der letzte Teil. Dabei wäre noch so viel zu sagen, so viele Fragen stellen sich, die weit ins neue Jahr reichen.
Der fünfte Teil könnte von den Kitas handeln. Davon, dass Deutschland so viel wie nie zuvor in die frühkindliche Bildung investiert und dass das Geld doch nicht reicht. Während sich zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommerns SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig zu Jahresanfang selbst per Twitter feierte, dass die Kinderbetreuung im Land nun komplett gebührenfrei ist, finanziert mit den Bundesmillionen aus dem Gute-Kita-Gesetz, verschwieg sie den Preis: Nirgendwo sonst sind die Kitas so spärlich mit Erziehern besetzt wie im Nordosten. Die alles entscheidende Frage ist auch Anfang 2020 unbeantwortet, und zwar bundesweit.
Sie lautet: Wie kann der ErzieherInnenberuf so attraktiv werden, dass nicht nur mehr junge Leute sich für ihn entscheiden, sondern auch nach der Ausbildung in ihm auf Dauer arbeiten wollen? Ganz sicher nicht mithilfe der Schmalspur-Reform, die die Kultusministerkonferenz im Stillen vorantrieb und erst stoppte, als die Szene im Herbst Wind davon bekam. Fest steht: Die Verteilung der Bildungschancen, die in Deutschland überdurchschnittlich stark von der sozialen Herkunft bestimmt wird, beginnt in den Kitas. Ohne hochklassige frühkindliche Bildung wird die Schieflage nicht geringer.
Der fünfte Teil könnte von den Ganztagsschulen handeln. Von dem Bundesprogramm, das den von der GroKo versprochenen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung bis 2025 finanzieren soll. Doch was wird das kosten? Das Sondervermögen von zwei Milliarden Euro, das die zuständigen Bundesministerinnen Franziska Giffey (Familie) und Anja Karliczek (Bildung) für Investitionen auf den Weg gebracht haben, wird kaum mehr als ein erster Schubs sein. Seit Monaten streiten sich Bund und Länder darum, wie hoch die dauerhaften Mehrkosten liegen werden, die – fordern die Länder – ebenfalls voll der Bund übernehmen muss. Wozu der nicht grundsätzlich nein sagt, aber auf die Berechnungsgrundlage kommt es eben an. Das Deutsche Jugendinstitut (DJI) spricht inzwischen von Investitionen in Höhe von 7,5 Milliarden Euro bis 2025 und von zusätzlichen 4,5 Milliarden Euro jährlich für den Betrieb. Doch was sagen solche Werte? Vor allem, dass sie von vielen politischen Annahmen abhängen: dass nur rund 75 Prozent der Kinder ihr Ganztags-Recht in Anspruch nehmen zum Beispiel. Dass der von den Eltern gewünschte tägliche Betreuungsumfang nicht anders ausfällt, als die Experten es erwarten. Nur so kommt man auf die bis zu 1,1 Millionen zusätzlichen Ganztagsplätze, auf die Bund und Länder sich als Verhandlungsgrundlage geeinigt haben. Und was die für sie nötigen Betriebskosten angeht: Um die überhaupt ausgeben zu können, müssen erstmal auch die zusätzlichen Fachkräfte ausgebildet werden. Und was sind die meisten von denen? ErzieherInnen. Die, siehe die Kitas, ohnehin schon Mangelware sind.
Vielleicht sollte über diesen Umstand in 2020 mehr geredet werden, anstatt Milliarden zu verplanen für das Gehalt von Leuten, die es möglicherweise gar nicht gibt. Noch spannender würde die Debatte, wenn man die Ganztags-Idee endlich mal politisch zu Ende denken würde: eben nicht vorrangig als Betreuung. Sondern als Bildung. Mit verpflichtendem Ganztagsunterricht und einem Wechsel zwischen Phasen der Entspannung und der Konzentration. Nur dadurch, sagen die meisten Experten, würde die Ganztagsidee wirklich ihr pädagogisches Potenzial ausspielen und auch für mehr Bildungsgerechtigkeit sorgen. Doch dafür bräuchte man dann auch noch mehr Lehrer zu den Erziehern. Und sind die Grundschullehrer nicht auch gerade Mangelware? Ja, noch. Allerdings zeigen neue Prognosen der KMK, dass sich der Trend von 2025 an umdrehen könnte. Welche bessere Verwendung für den drohenden Lehrer-"Überschuss" könnte es geben?
Der fünfte Teil könnte auch von der Stiftung für Hochschulzulassung (SfH) handeln. Oder, womit die meisten Leute mehr anfangen können, von der Zulassung zum Medizinstudium. Die, so hat das Bundesverfassungsgericht vorgeschrieben, muss 2020 erstmals nach neuen Regeln laufen. Doch klappt der Neustart? Oder scheitert sie am Software-Chaos? Die zuständige Stiftung ist jedenfalls gerade dabei, sich ehrlich zu machen. So unterstützenswert das ist, so ernüchternd ist das Ergebnis: Die 2009 gestartete, viele Millionen Euro teure Software hinter der Online-Studienplatzvergabe DoSV ist nicht mehr zu retten. Und Experten prophezeiten der Stiftung in einem internen Gutachten: Das jetzt startende Software-Provisorium für das neue Medizin-Verfahren wird nicht wie versprochen zwei Jahre dauern, sondern fünf. Hauptsache, es läuft überhaupt. Nächste Woche, am 15. Januar, ist Bewerbungsschluss. Dann ist Zeit für eine erste Bilanz. Mal sehen, wie schmerzhaft sie wird.
Ich könnte über die Gefahren von Wissenschaftsskepsis und nationalen Egoismen warnen, die den Austausch in Wissenschaft und Forschung erschweren und den neuen Präsidenten des Deutschen Akademischen Austauschdienstes Joybrato Mukherjee zu folgenden Sätzen bewegten: "Wir müssen in die Arena einsteigen und kämpfen, wir müssen selbstbewusst vertreten, dass eine gedeihliche Entwicklung unserer Gesellschaft nur möglich ist mit einer freien Wissenschaft unter freien Bedingungen. Im Schlafwagen werden wir die Wissenschaftsfreiheit nicht verteidigen."
Ich könnte den fünften Teil auch der Wissenschaftskommunikation widmen, dem Paper von Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU), dem Aufschlag der Berliner Regierungsfraktionen und den verhalten-säuerlichen Reaktionen aus der Szene.
Ich könnte in diesem fünften Teil fragen, wie sich 2020 die Debatte um mehr Dauerstellen in der Wissenschaft entwickelt, welche endgültige Form das von 2021 an geltende Forschungsrahmenprogramm der Europäischen Union bekommen wird – mit einer Kommissarin, die neben Innovation und Jugend jetzt doch auch in ihrem Titel für "Bildung und Forschung" zuständig sein darf. Ich könnte Prognosen über den weiteren Verlauf der DEAL-Verhandlungen, über eine möglicherweise bevorstehende Einigung mit Elsevier, abgeben. Über die Zukunftsfähigkeit der BaföG-Studienförderung könnte ich schreiben, über ihre Höhe und Logik oder auch über die lange versemmelte Digitalisierung der Antragstellung, die im zweiten Anlauf jetzt richtig klappen soll. Ich könnte angesichts der von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) losgetretenen Personaldiskussion auch nochmal die Chancen abwägen (ich halte sie nicht für schlecht!), dass Anja Karliczek im Dezember 2020 noch Bundesbildungsministerin sein wird.
Ich könnte am Ende dieser Woche des Ausblicks aber auch ein Thema in den Vordergrund stellen, das für mich zunehmend zur Schicksalsfrage deutscher Reformfähigkeit wird: Wie können wir die Führungspositionen in Deutschlands Wissenschaft (und anderswo) endlich bunter besetzen, wann endlich spiegeln die Hochschulen und Forschungseinrichtungen jene Vielfalt wider, die unsere Gesellschaft prägt: in Hinblick auf Alter, Gender, ethnische, nationale und soziale Herkunft. Was muss noch alles schiefgehen, wieviel Mittelmäßigkeit wollen wir uns noch leisten, bis sich die Erkenntnis durchsetzt: Diversität ist kein Gedöns, kein Gutmenschentum, sondern die wichtigste, die zentrale Voraussetzung für Ideenreichtum und künftige Exzellenz?
All diesen Themen und sicher noch vielen weiteren hätte ich den letzten Teil meines Ausblicks widmen können. Jetzt ist er ein Potpourri geworden. Vielleicht ist das die beste Lösung. (10.01.20)
Fotos: xresch: "Analytik Informatik Innovation", CC0/Pixabay. /Sir James: "2015-02-28 Bonn Graurheindorfer Str 157 KMK.JPG", CC BY-SA 3.0./TheDigitalArtist: "Idee Gedanken Innovation", CC0/Pixabay./stefan1024: "lassen Sie mich Arzt ich bin durch", CC0/flickr. /Peggychoucair: "Glaskugel", CC0/Pixabay.

Kommentar schreiben